Wie ein Wissenschaftsthriller unser Denken über Gemeinressourcen veränderte.
Kaum eine naturwissenschaftliche Veröffentlichung der letzten 50 Jahre verhalf einer wissenschaftlichen Karriere derart schnell in die Höhen des wissenschaftlichen Olymps, wie der 1968 veröffentlichte Artikel „The Tragedy of the Commons“. Dessen Autor, der amerikanische Biologe Garrett Hardin, hatte für den Beitrag keine langjährigen Feldstudien präsentiert, er hatte keine methodisch-komplizierten Experimente entworfen, Hardin hatte einfach nur beobachtet und postuliert: dass die Nutzung von natürlichen Ressourcen ohne staatliche oder privatisierte Verwaltung letztendlich zu deren nichtregenerierbarer Vernichtung führen würde. Zu einer Zeit, in der die Thematik der Commons nicht einmal in der wissenschaftlichen Literatur vorhanden war, brachte Hardin mit seinem Beitrag im Fachmagazin „Science“ Ökonomen, Politiker, ja ganze Gesellschaften dazu, über Ressourcenmanagement zu diskutieren.
Aber der Reihe nach. Was ist nun die Tragik der Allmende (wie der Titel auf Deutsch übersetzt lautet)? Das folgende Beispiel der Commons kennt vielleicht der eine oder andere, es ist sozusagen Hardins „Klassiker“: Man stelle sich ein frei zugängliches Feld vor, dass über eine begrenzte Fläche zum Grasen verfügt. Ein Feld eben, wie es in ländlichen Regionen tausendfach vorkommt. Nun gibt es eine Gruppe von Menschen, für die das Feld eine Ressource ist. Jeder Hirte, so Hardin, will so viele seiner Schafe wie möglich auf einem räumlich begrenzten Feld weiden lassen. Mit jedem zusätzlichen Schaf bringt der individuelle Hirte die Ressource „Feld“ in Bedrängnis – bis sie schließlich so überbewirtschaftet wird, dass kein einziges Schaf mehr auf ihr weiden kann. Der finale Akt der Tragödie ist, dass alle Hirten somit ihre lebenswichtige Ressource (Schaf) verloren haben, weil niemand sich verantwortlich für den Erhalt des Feldes sieht. Die Logik hinter dieser Tragödie lässt sich auf andere Ressourcen, zu denen theoretisch alle Zugang haben, erweitern: Edelmetale, Klima oder Trinkwasser.
Rationale Tragik
Hardin folgte in diesen Szenarien strikt dem etablierten Menschenbild des Homo oeconomicus’: Die einzelnen Hirten handeln genau dann rational, wenn sie es verstehen, sich einen tatsächlichen Mehrwert mit den begrenzten und verfügbaren Ressourcen zu verschaffen. Jedes weitere Schaf, das ein Hirte durchbringt, hat somit einen echten zusätzlichen Nutzwert. Handeln aber alle Beteiligten rational, stirbt die Ressource. Daher sprach Hardin auch explizit von einer „Tragik“. Denn gerade weil (ökonomisch) rational gehandelt wird, ist die Ressource ja in Gefahr: Ihr Ende ist besiegelt, es ist unausweichlich.
Hardin ging davon aus, dass Menschen ohne die Intervention des Staates beziehungsweise ohne das Regelwerk der Privatisierung eine frei öffentlich-zugängliche Ressource über einem nachhaltigen Gleichgewicht hinaus bewirtschaften. Die Privatisierung würde im Fall der Hirten eine Aufteilung der Ressource in gleichwertige Teile bedeuten. So gibt es nicht mehr das gemeinschaftlich-öffentliche Feld, sondern Peters, Pauls, oder Paulinas privates Feld. Eine gemeinschaftliche Einigung der Hirten untereinander, meinte Hardin, ohne eine privatisierende Aufteilung der Ressource oder eine staatliche Intervention kann es nicht geben.
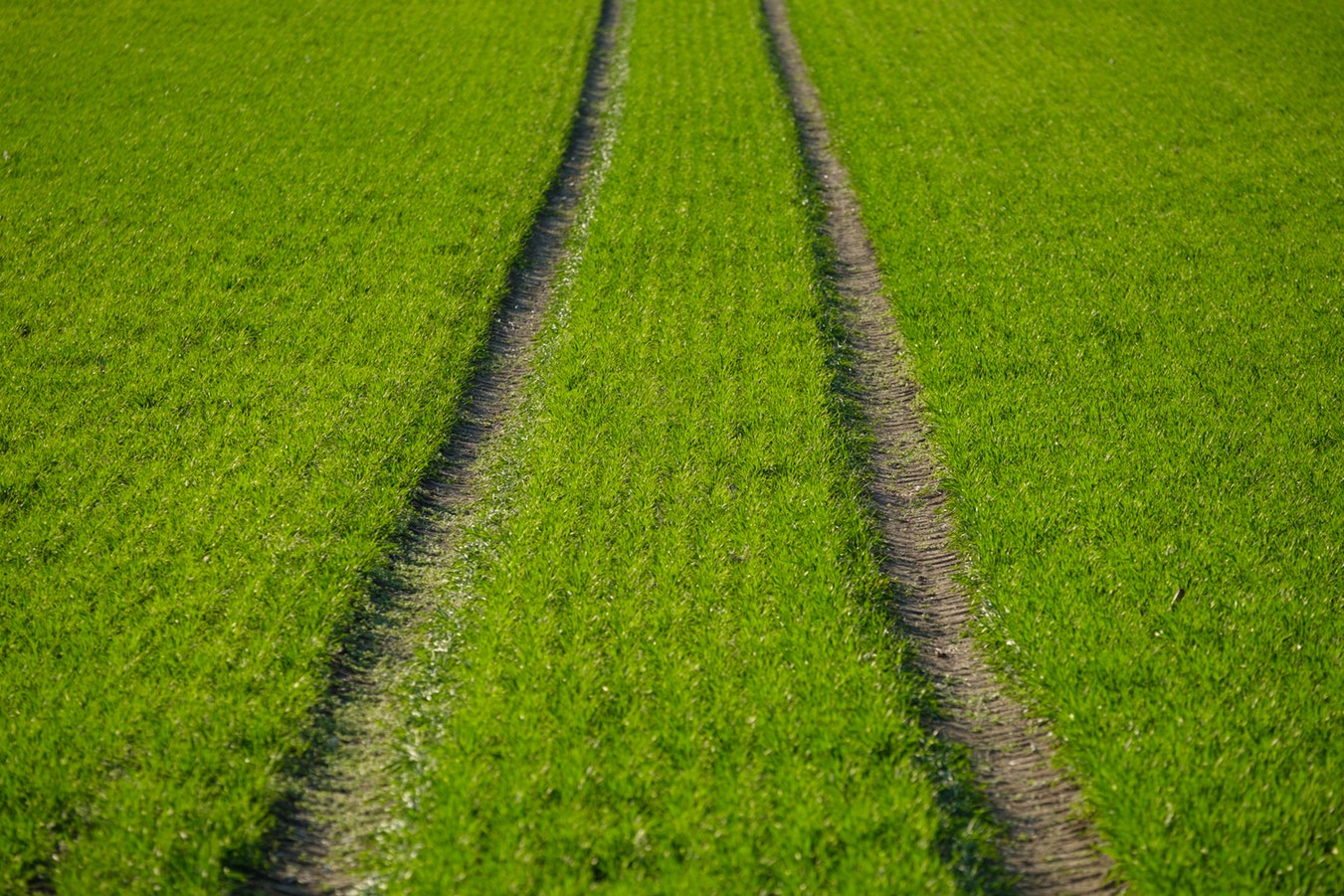
Ohne einer geeigneten Ordnung lässt sich kaum nachhaltig wirtschaften. (c) Samuel Zeller
Doch wie es ein echter wissenschaftlicher Thriller so will, lag Hardin spektakulär falsch. Seine Theorie der Tragik der Allmende wurde über Jahrzehnte hinweg empirisch falsifiziert und zwar von der Amerikanerin Elinor Ostrom. Für ihre Arbeit zu den Commons erhielt sie 2009 als erste Frau den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Ostrom führte auf der ganzen Welt Feldstudien über das Verhalten von Menschen gegenüber frei zugänglichen Ressourcen durch. Egal ob die Fischereien von Maine, die Bergdörfer der Schweiz oder Japan, nepalesische Wälder oder spanische Bewässerungssysteme, Menschen schaffen es überall, sich dezentralisiert und unabhängig externen Kontrollsysteme Regeln zu geben, um ihre Ressourcen nachhaltig zu bewirtschaften.
Grundlegende Eigenschaften des Commoning
Aber was macht erfolgreiches Commoning aus? Das Commoning ist eine bestimmte Art des Wirtschaftens, die weder die „für-jeden-das-Gleiche“-Utopien des Kommunismus abbilden noch in irgendeiner anderen Art und Weise exotisch-archaischen Gesellschaftsformen zugeordnet werden können. Es gibt aber ein paar grundlegende Unterschiede zur Wirtschaftslogik der Privatisierung.
Erstens gibt es im Commoning niemals einen Exklusivbesitz auf eine Ressource, sondern immer einen Mitbesitz. Ich kann also nicht einfach mit einem Teil der Ressource machen, was ich will – wie das zum Beispiel in gewisser Weise mit meinem exklusiven Eigentum möglich ist, sondern ich bin für den Teil des Mitbesitzes der Ressource verantwortlich. Die Verantwortung ist meistens, nicht immer, proportional nach der Nutzung gegenüber der Ressource geregelt.
Zweitens ist ein ganz entscheidender Faktor bei jeder Form der Allmende der Prozess, in dem die Regeln der Nutzung festgelegt werden. Die Privatisierung ermöglicht es, demjenigen, der die Ressource besitzt – meistens und im gewissen Maße – die Nutzungsregeln dieser Ressource zu bestimmen. Dies ist fundamental anders in Allmenden. Der Regelkanon muss von allen Beteiligten, also allen Mitnutzern der Allmende, partizipativ und in mehreren Schritten erstellt werden. Entscheidend ist hierbei auch nicht, sogenannte „Best-Case-Szenarien“ heranzuziehen und möglichst getreu zu kopieren und zu implementieren. Entscheidend ist, dass es für die Ressourcenverwaltung des Commoning kein Patentrezept gibt und auch nicht geben soll. Die Regeln zur Verwaltung der Ressource muss immer an den Ort mit seinen Eigenartigkeiten, seinen natürlichen Gegebenheiten, seiner Historie angepasst werden. Daher hat Ostrom auch nie versucht, einen Regelkanon für Allmenden zu entwerfen, sondern prinzipielle Bausteine, die die fundamentalen Bedingungen spezifizieren.
Die Hochgebirgsweiden im schweizerischen Törbel
Einer der ersten Gemeinschaften, die Ostrom in ihren Feldstudien analysierte, waren die Bewohner des Hochgebirgsdorfs Törbel im Kanton Wallis der Schweiz. Der niedrigste Punkt des Dorfes befindet sich auf etwa 700, der höchste auf knapp 3.000 Meter. Das Dorf hat also eine spezielle topologische Anbaustruktur – entlang des Bergstiegs zwischen Vor- und Hochalpen.

Im schweizerischen Tröbl gilt auch heute noch die sogenannte „Winterregel“. (c) Ivan Louis
Ostrom untersucht zunächst das soziale Gefüge der Dorfgemeinschaft. Auffallend ist die Übereinstimmung der einzelnen Bewohner hinsichtlich der Zukunft des Dorfes: es besteht ein allgemein großes Interesse, das Dorf für die nächsten Generationen lebenswert zu konservieren. Die meisten Bewohner leben von der Viehzucht und versorgen sich heute noch teilweise selbst. Ab etwa 2.000 Metern beginnen die Hochalpen, dessen Weiden in der heißen Jahreszeit für den Weidegang des Viehs genutzt werden können. Dieser Teil des Dorfes ist nicht privatisiert und somit das Fundament der Allmende in Törbel. Hier würde sich nach Hardin nun die Tragik entfalten, denn jeder Bewohner würde nun versuchen, das Maximum an Weidefläche für sich herauszuschlagen. Nicht in Törbel. Denn Dank der 1517 festgelegten „Winterregel“ von Törbel ist die Anzahl des Viehs, die jeder Bauer auf die Alm bringen darf, auf die Anzahl reglementiert, die er selbstständig durch den Winter bringen kann. Der Schweizer Ethnograph Gottfried Stebler, der bereits in Tröbel geforscht hatte, berichtet 1922 von zusätzlichen Verpflichtungen, derer sich ein Bauer bei einer bestimmten Zahl Vieh annehmen muss: Ab der siebten Milchkuh ist eine Abgabe pro Kuh zu Zahlen sowie einen Tag Arbeit pro zusätzlicher Kuh für die Restaurierung und Instandhaltung der Weide-Infrastruktur zu leisten. Törbel hat heute auch noch eine Alpenkommission, die sich um die regelmäßigen Verwaltungsaufgaben kümmert, wie zum Beispiel die Kostenverteilung der Allmende, die Messung der Milchquantität pro Kuh oder die Verteilung des Käses pro Milchmenge einer Kuh.
Ostroms Grundprinzipien einer Allmende
Am Beispiel Törbels kann man auch die polyzentrischen Strukturen der Organisation der Allmende erkennen, die Ostrom als Grundprinzip der Gemeingüterverwaltung sieht. Eine Allmende wird über verschiedene – dem kulturellen und sozialen Gegebenheiten des Ortes entsprechenden – hierarchischen Strukturen aufgebaut. In Törbel zum Beispiel wählt jeder Nutzer die Alpkommission als eine Regulierungsinstanz, entledigt sich damit aber nicht jeglicher Verantwortung gegenüber der Allmende. Wie Ostrom in ihren anderen Studien immer wieder feststellte, ist eine Allmende alles andere als ein „free-for-all“-Ressourcenraum. Im Gegenteil: Sie ist von den Beteiligten sehr stark reglementiert. Ostrom formulierte insgesamt elf Grundprinzipien der Allmende:
- Bedeutung: Die Allmende ist der dritte Weg zwischen Privatisierung und Verstaatlichung.
- Grenzen: Eine Allmende ist kein Selbstbedienungsladen. Es gibt eine Grenze zwischen denen, die sie nutzen können, und den Ausgeschlossenen.
- Regeln: Es gibt kein allgemeines Gesetz der Allmende. Sie sind an den Ort der Allmende angepasst.
- Anerkennung: Die Allmende funktioniert, wenn staatliche Institutionen sie und ihre Regeln anerkennen.
- Ressourcen: Die Allmende baut Ressourcen für die geteilte Nutzung auf.
- Nutzen: Gemeinressourcen ermöglichen den Nutzern mehr Auswahl, Information und Verfügungsmacht.
- Kosten: Gratis ist eine Lüge. Die Allmende kostet. Sie muss aufgebaut, unterhalten, geregelt, und überwacht werden. Die Kosten werden proportional zur Verteilung des Nutzens aufgeteilt. Keiner nimmt kostenlos beliebig viel mit.
- Überwachen: Die Einhaltung der Regeln und der Zustand der Ressourcen müssen kontinuierlich überwacht werden.
- Konflikt: Streit und Auseinandersetzungen werden schnell, günstig und direkt gelöst. Die Regeln werden gemeinsam abgemacht.
- Strafe: Wer Regeln verletzt, wird bestraft. Die Strafen reichen bis zum Ausschluss aus der Allmende.
- Ende: Für den, der nicht mitwirken kann oder will, muss der Ausstieg geregelt sein.
(Aus der 2017 herausgegebenen Sonderausgabe der „Hochparterre“ zum Thema „Sharing“)
Grenzen der Allmende
Ist die Allmende nun eine Wirtschaftsform, die unseren Planeten besser und nachhaltiger macht als die Privatisierung – und das grundsätzlich? Nein. Für eine erfolgreiche Allmende müssen bestimmte Faktoren zusammenkommen. Da wäre zum Beispiel die überschaubare Anzahl an Akteuren. Zwar sagt Ostrom explizit, dass die Nutznießer einer Allmende allein durch ihr gegenseitiges Interesse an der Ressource verbunden sein müssen, es wird aber auch immer wieder die Bedeutung der sozialen Beziehungen, das Vertrauen untereinander, hervorgehoben. In einer Welt der technologischen Infrastrukturen, die Menschen die Möglichkeit geben spontan wegzuziehen oder sich global und digital auszutauschen, ist es fraglich, ob die Allmende sich festigen und ihre Stärke ewahren kann. Grundsätzlich zeigt sie aber eines ganz sicher: der Mensch ist nicht notwendigerweise ein Homo oeconomicus, sondern ein kooperatives Wesen, dass eine Ressource nachhaltig und balanciert für die künftigen Generationen konservieren kann.
(c) Titelbild: Rod Long



